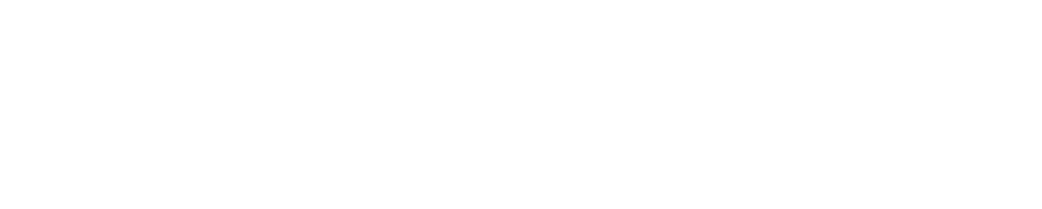Hallo zusammen,
kann jemand nachvollziehen weshalb im Zeitraum 1708 bis 1716 in Harbke Einträge doppelt, offensichtlich von zwei Schreibern in verschiedenen Büchern erfasst wurden?
Es gibt das Kirchenbuch 1674 - 1716
 www.archion.de
www.archion.de
Und Taufen 1708 - 1799
 www.archion.de
www.archion.de
Im Zeitraum der Überschneidung wurden die selben Geburten zweimal erfasst. Für mich ist das besonders spannend, da so eindeutig eine Namensveränderung meiner Vorfahren dokumentiert wurde (in einem Buch so, im anderen so). Ich würde gerne verstehen, wie es zu dieser Dopplung kam. Eine einfache Kopie scheint es nicht zu sein. Die Ereignisse wurden offenbar doppelt, von verschiedenen Personen erfasst. Möglicherweise spanned wer die Schreiber waren (ggf. bzgl. Herkunft und daher möglw. anderer Aussprache/Dialekt etc.).
Es kann sein das sich hierzu Hinweise in den beiden Büchern befinden. Diese konnte ich in der Vergangenheit nicht entziffern. Aktuell habe ich leider auch keinen aktiven Pass.
Über Hinweise zur Lösung des Rätsels würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Lars
kann jemand nachvollziehen weshalb im Zeitraum 1708 bis 1716 in Harbke Einträge doppelt, offensichtlich von zwei Schreibern in verschiedenen Büchern erfasst wurden?
Es gibt das Kirchenbuch 1674 - 1716
Harbke
Und Taufen 1708 - 1799
Harbke
Im Zeitraum der Überschneidung wurden die selben Geburten zweimal erfasst. Für mich ist das besonders spannend, da so eindeutig eine Namensveränderung meiner Vorfahren dokumentiert wurde (in einem Buch so, im anderen so). Ich würde gerne verstehen, wie es zu dieser Dopplung kam. Eine einfache Kopie scheint es nicht zu sein. Die Ereignisse wurden offenbar doppelt, von verschiedenen Personen erfasst. Möglicherweise spanned wer die Schreiber waren (ggf. bzgl. Herkunft und daher möglw. anderer Aussprache/Dialekt etc.).
Es kann sein das sich hierzu Hinweise in den beiden Büchern befinden. Diese konnte ich in der Vergangenheit nicht entziffern. Aktuell habe ich leider auch keinen aktiven Pass.
Über Hinweise zur Lösung des Rätsels würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Lars