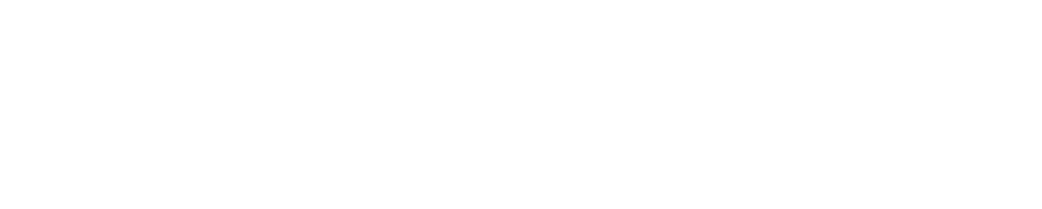müller-baur
Archion-Team
Zum 1. Mai tritt in Deutschland das neue Namensrecht in Kraft, das einige Änderungen für die Namensführung im Gepäck hat. Grundlegendes Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Namenswahl flexibler und einfacher zu gestalten. Eine der neuen Regelungen erlaubt das Führen von Doppelnamen für beide Ehepartner und ermöglicht zudem eine Schreibweise ohne Bindestrich, was weitere Flexibilität bietet. Selbst in bestehenden Ehen können diese Änderungen vorgenommen werden. Auch Kinder können in diesem Zusammenhang zukünftig Doppelnamen tragen. Vereinfachte Anpassungen auch andersherum: Bei Scheidungen werden Änderungen im Nachnamen bei Kindern nun ohne komplizierte Verfahren und auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnitten vollzogen. Zudem darf ein Kind bei Volljährigkeit einmalig, innerhalb gewisser Grenzen, über seinen Geburtsnamen entscheiden. Des Weiteren enthält das neue Gesetz spezielle Regelungen für nationale Minderheiten, um namensrechtliche Traditionen zu wahren, und ebenso die Möglichkeit der Wahl einer geschlechtsangepassten Form des Ehenamens. Gewiss ist, dass diese Gesetzesänderung einiges an Bewegung in die Welt der Namen bringt – und damit unweigerlich Auswirkungen auf die Familienforschung haben wird.
Spannend ist zudem die Frage, wie Genealogie heute aussähe, wenn das Namensrecht in der Vergangenheit bereits auf diese Weise geregelt gewesen wäre.
Was ist Ihre Meinung?
Welche Chancen oder Herausforderungen sehen Sie durch das neue Namensrecht im Hinblick auf die genealogische Forschung? Mit welchen Auswirkungen auf die Familienforschung rechnen Sie? Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Beobachtungen dazu hier in den Kommentaren.
Spannend ist zudem die Frage, wie Genealogie heute aussähe, wenn das Namensrecht in der Vergangenheit bereits auf diese Weise geregelt gewesen wäre.
Was ist Ihre Meinung?
Welche Chancen oder Herausforderungen sehen Sie durch das neue Namensrecht im Hinblick auf die genealogische Forschung? Mit welchen Auswirkungen auf die Familienforschung rechnen Sie? Wir freuen uns auf Ihre Gedanken und Beobachtungen dazu hier in den Kommentaren.